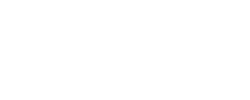Michael Fehr
"Farbenglanz"
Zu ihrer Ausstellung in der Reformierten Kirche in Radevormwald schrieb Gabriele Schade-Hasenberg: "Ich hoffe, dass sie (...) einem Bedürfnis nach Konzentration, innerer Einkehr und Ruhe entgegen kommt. Dies nicht mit Hilfe religiöser Motive, sondern durch die Reduktion auf die Farbe als alleinigem Bildinhalt. Ihre nicht-figurative Darstellung ist ein Angebot an den Betrachter, sich ihr intensiv anschauend gegenüber zu verhalten. Ein konzentriert, konzentrierendes Wahrnehmen, in dem sich das Bild allein erschließt, könnte dann vielleicht als eine Rückwirkung zu einem modernen 'Andachtserlebnis' führen."
Im gleichen Text erwähnt Gabriele Schade-Hasenberg, dass sie sich in Vorbereitung für die Ausstellung mit den Mariendarstellungen insbesondere des Fra Angelico beschäftigt habe, und erklärt, dass sie sich bei der Auswahl der Bilder für die Ausstellung an deren Farbgebung – dem Blau des Mantels der Maria, dem Rot ihrer Bekleidung und der des Jesusknaben sowie dem Grün der Landschaftsdarstellung – orientierte.
Mit den neun monochromen Bildern, die Gabriele Schade-Hasenberg in der Ausstellung zeigte, ergab sich jedoch nicht allein aufgrund der vergleichbaren Farbgebung eine Anspielung auf Fra Angelicos Mariendarstellungen (ich habe hier vor allem das Annalena-Altarbild aus dem Jahre 1435 im Museo di San Marco in Florenz vor Augen); vielmehr entstand mit ihrer Installation in der Reformierten Kirche Radevormwald eine Strukturverwandtschaft zwischen der Ausstellung und dem historischen Bild, auf die ich zunächst eingehen möchte.
Fra Angelicos Altarbild ist ein frühes Beispiel für den im Italien des 15. Jahrhunderts entstanden Bildtypus der so genannten Sacra Conversazione, in dem die thronende Madonna von Heiligen umgeben erscheint. Das Charakteristische dieses Bildtypus ist, dass alle Figuren in einem einheitlichen Raum stehend dargestellt werden, der aufgrund seiner perspektivischen Konstruktion als virtuelle Erweiterung des Raumes wahrgenommen werden kann, in dem sich der Betrachter des Bildes befindet. Allerdings ist in einer Sacra Conversazione nie eine dialogische Situation dargestellt, sondern sind die Figuren in der Regel en face gezeigt (nur bei der Darstellung des Jesusknaben wird dieses Motiv zuweilen durchbrochen). Insoweit ist der im 19. Jahrhundert entwickelte Begriff irreführend und darf nicht als Beschreibung des Dargestellten verstanden werden, sondern meint die Bezeichnung eines möglichen dialogischen Verhältnisses zwischen Bildbetrachter und Dargestellten.
Damit ist im Grunde schon gesagt, worin die Strukturverwandtschaft zwischen der Ausstellung und diesem Bildtypus besteht. Denn versteht man einerseits den Kirchenraum als eine Rahmung der Bilder von Gabriele Schade-Hasenberg und nimmt man andererseits das historische Bild vorikonographisch, d.h., als eine noch nicht ausgedeutete Konstellation von Formen und Farben wahr, die auf den Betrachter Bezug nimmt, dann kann man sich in der Ausstellung der Künstlerin in eine radikalisierte Form der Sacra Conversazione versetzt sehen: Ebenso, wie im historischen Bild die Madonna mit dem Kind und die Heiligen dem Betrachter als ein Gegenüber erscheinen, sieht er sich in der Kirche mit den nicht-figurativen Gemälden konfrontiert, doch im Unterschied zum historischen Bild nicht in einem virtuellen Raum, sondern unmittelbar, in einem direkten Verhältnis, in der gleichen räumlichen Situation.
Dass dieses Verhältnis zwischen den Bildern und ihrem Betrachter als ein besonderes und nicht als das in Galerieräumen oder Museen übliche Verhältnis wahrgenommen wird – man überhaupt auf die Idee
einer Sacra Conversazione–Situation kommen kann – ist allerdings allein dem Umstand zuzuschreiben, dass die Ausstellung in einem Kirchenraum und damit einem Kontext stattfand, der den
Bildern einen spezifischen, religiös begründeten Rahmen gab. Dieser Rahmen ist jedoch wiederum selbst ein besonderer, weil er ein Kultusraum der Reformierten Kirche und damit der einer
Glaubensrichtung ist, in der ein Bilderverbot gilt. Das Kirchengebäude in Radevormwald sieht daher wie die der Reformierten Kirche anderer Gemeinden keine Orte für Bilder vor – und bietet tatsächlich
keine an: Auch die Installationsaufnahmen der Ausstellung lassen gut erkennen, dass die Gemälde keine wie immer hervorgehobenen Plätze im Raum einnehmen, sondern nur da, wo genügend freie Wandflächen
zur Verfügung standen, das heißt, vor allem zwischen Fenstern gehängt werden konnten. Anders als
bei Ausstellungen zumal in katholischen Kirchen, konnten die Bilder daher hier nicht an die Stelle schon vorhandener treten, und blieb deshalb auch der liturgische Raum in seiner Struktur nicht
unberührt; vielmehr zog mit den Gemälden von Gabriele Schade- Hasenberg eine auf ihnen aufbauende, nur durch sie konstituierte, neue Struktur in den Kirchenraum ein, die von Besuchern der Kirche
notwendig als eine eigene wahrgenommen werden musste.
Die Ausstellung war mithin ein recht riskantes Unternehmen: Denn Gemälde in einem Raum zu zeigen, der explizit nicht für das Vorzeigen von Bildern gemacht ist, doch sie aufgrund seiner eindeutig religiösen Widmung entsprechend konnotiert, war nicht zuletzt auch im Hinblick auf die ganz praktische Frage, wo sie denn in diesem Raum so gezeigt werden könnten, dass sie sich darin zu behaupten und ihre Wirkung zu entfalten vermöchten, keine einfache Aufgabe.
Die gelungene Lösung dieser Aufgabe war, die Gemälde an den Außenwänden des Kirchenraums so zu hängen, dass sie wie Magnete aufeinander Bezug nehmen konnten und dabei den Kirchenbesucher umfingen; mithin, dass er sie wahrnehmen musste, wohin – ausgenommen den zentralen Bereich mit Kanzel, Kanzeltisch und Orgel – er auch blickte; und schließlich, dass eines der Bilder zu betrachten dazu führte, auch sein Gegenüber im Raum wahrzunehmen und ihr wechselseitiges Verhältnis in der Reflexion als einen Dialog zu aktivieren. Auf diese Weise erschien die Ausstellung nicht nur als eigenständige, vom Raum unabhängige Installation und zugleich in ihn integriert, sondern bot ideale Voraussetzungen für eine Auseinandersetzung mit der Malerei der Künstlerin.
Gabriele Schade-Hasenberg malt monochrom erscheinende Bilder in unterschiedlich großen Formaten, die eine einfache innere Strukturierung – eine Aufteilung der Bildfläche in rechteckige Formen – weniger erkennen als erahnen lassen, auf die sie in ihrer letzten Werkphase ganz verzichtet. Für ihre Gemälde ist in jedem Fall charakteristisch, dass sie das Licht sowohl in sich aufzusaugen scheinen als auch reflektieren: Die Farben ihrer Bilder – Rot, Grün, Blau, aber auch Mischtöne wie zum Beispiel Orange – treten daher in einer eigentümlichen Doppelfunktion als leuchtende Farbmaterie und als reflektierende Oberfläche zugleich auf, ohne dass es möglich wäre, die eine oder andere Funktion genauer zu bestimmen. Wie andernorts ausführlich und genau beschrieben, resultiert dieser Effekt aus ihrer speziellen Kombination von Tempera- und Ölmalerei, bei der zahlreiche, sehr dünne Farbschichten auf die Bildfläche aufgetragen werden.1 Das Ergebnis sind Bilder, deren Wirkungen als Farbphänomene sich der wortsprachlich-begrifflichen Erfassung weitgehend entziehen. So liegt ihnen denn auch kein Konzept im Sinne eines disegno zugrunde, vielmehr entstehen sie ausschließlich als Malerei, in einem ganz der jeweiligen Farbe gewidmeten Prozess, bei dem die Künstlerin deren Qualitäten auslotet und ihren möglichen Differenzierungen und Nuancierungen nachgeht. So kann zum Beispiel in einem hell-roten Bild ein dunkleres Rot erscheinen, ohne dass sich dessen Grenzen bestimmen ließen, und dass, obwohl dunkler, zu leuchten und die Lichtreflexe der helleren Partien wie zu überstrahlen scheint: Weil das Auge in Gabriele Schade-Hasenbergs Gemälden keinen Haltepunkt findet, von dem aus das jeweilige Bild erschlossen werden könnte, lösen sie bei ihrem Betrachter eine regelrechte Wahrnehmungskrise aus. Denn obwohl man eindeutig ein Rot, ein Blau oder Grün zu sehen vermeint, erweist sich dieses Rot, Blau oder Grün bei näherer Betrachtung als in sich so differenziert, dass sich die Vorstellung von einer bestimmten Farbe in ihrer Wahrnehmung auflöst.
Indem sich die Gemälde sprachlich basierten Definitionen, mit denen wir uns gewöhnlich Wahrnehmungsphänomene gefügig zu machen versuchen, vollständig entziehen, also als konkrete und zugleich unbestimmbare Tatsachen auftreten, stellen sie dem Betrachter eine nicht abschließbare Wahrnehmungsaufgabe. Sie widerspricht in einem formalen Sinn der Verkündigung des religiös begründeten Worts, für die der Kirchenraum konzipiert wurde. Doch erscheint die Ausstellung in ihm nicht als Fremdkörper. Denn wie es bei der Verkündigung des religiösen Worts um das Bemühen geht, etwas, das sich unserer Erfahrung prinzipiell entzieht, zur Sprache zu bringen, so kann sich in der Auseinandersetzung mit den Gemälden der Künstlerin als unmittelbares Erlebnis die Erfahrung einstellen, dass das, was wir wahrnehmen können, das, was ist, nie vollständig erfassen kann. Insoweit mag man die Ausstellung von Gabriele Schade-Hasenberg als eine neue Form der Sacra Conversazione verstehen.
1 Vgl. Matthias Bleyl, Zu zwei Bildern von Gabriele Schade-Hasenberg (2000) in:
www.farbmalerei.org/Schade-Hasenberg